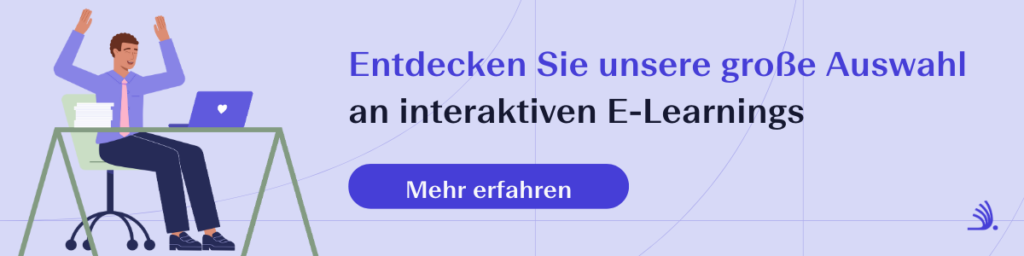Gendern: die Evolution geschlechtergerechter Sprache im Deutschen

In einer sich ständig weiterentwickelnden Welt, in der Gleichstellung und Inklusion immer mehr an Bedeutung gewinnen, spielt die Sprache, die wir täglich verwenden, eine zentrale Rolle. Sie beeinflusst, wie wir die Welt sehen, wie wir über sie denken und wie wir mit anderen interagieren. Eines der kontroversesten Themen in diesem Kontext ist das Gendern – die bewusste Verwendung von gendergerechter Sprache. Aber was bedeutet es eigentlich, zu „gendern“? Warum wird es oft leidenschaftlich diskutiert? Und wie hat sich die gendergerechte Sprache im Laufe der Jahre entwickelt? In diesem Blogartikel tauchen wir tief in die Welt des Genderns ein, um diese Fragen zu beantworten und ein klares Bild von der Bedeutung, Geschichte und den verschiedenen Ansätzen des Genderns im Deutschen zu zeichnen.
Was ist die Definition von Gendern?
Der Begriff „Gendern“ bezieht sich auf die bewusste Anwendung von gendergerechter Sprache. Gendergerechte Sprache (auch geschlechtergerechte oder geschlechtersensible Sprache) bezeichnet eine Form der Sprachverwendung, die darauf abzielt, alle Geschlechter gleichberechtigt und ohne Vorurteile oder Stereotypen darzustellen. Im Deutschen, wie auch in vielen anderen Sprachen, sind viele traditionelle Formulierungen männlich dominiert oder implizieren Geschlechterrollen, die nicht mehr den aktuellen gesellschaftlichen Vorstellungen von Gleichheit entsprechen. Das Urteil über die Verwendung gendergerechter Sprache ist geteilt; sie wird von manchen als notwendig und fortschrittlich und von anderen wiederum als überflüssig oder kompliziert betrachtet. Es gibt kein festes Regelwerk für die Rechtschreibung beim Gendern, aber viele Institutionen, Medien und Unternehmen haben eigene Leitfäden und Empfehlungen zum gendergerechten Sprachgebrauch entwickelt.
Warum ist Gendern wichtig?
Gendern ist aus verschiedenen Gründen wichtig, und obwohl die Meinungen über die Notwendigkeit variieren, lassen sich einige zentrale Argumente für gendergerechte Sprache identifizieren:
- Sichtbarkeit aller Geschlechter: Traditionelle Sprachgewohnheiten und Rechtschreibungen können dazu führen, dass bestimmte Geschlechter und ihre entsprechenden Personenbezeichnungen unsichtbar oder marginalisiert werden. Durch Gendern wird versucht, alle Geschlechter gleichberechtigt in der Sprache abzubilden.
- Bewusstsein und Sensibilisierung: Die Gendersprache kann das Bewusstsein für Geschlechtervielfalt erhöhen und zur Sensibilisierung beitragen. Es kann helfen, die Bedeutung von Inklusion und Diversität in der Gesellschaft hervorzuheben.
- Bekämpfung von Stereotypen: Geschlechtsspezifische Sprachgewohnheiten können stereotype Vorstellungen und Erwartungen über Männer, Frauen und andere Geschlechtsidentitäten verstärken. Durch eine gendergerechte Sprache können diese Stereotypen und vorschnelle Urteile herausgefordert und abgebaut werden.
- Respekt und Anerkennung: Gendersprache kann ein Zeichen von Respekt und Anerkennung gegenüber Personen sein, die sich nicht in den traditionellen Geschlechterkategorien „männlich“ und „weiblich“ wiederfinden. Dies beinhaltet insbesondere nicht-binäre, Gender-diverse und transgender Personen.
- Reflexion gesellschaftlicher Veränderungen: Sprache entwickelt sich ständig weiter und spiegelt gesellschaftliche Veränderungen wider. Das Gendern kann als ein Ausdruck der aktuellen Diskussionen und Anerkennungen von Geschlechtervielfalt und -gerechtigkeit gesehen werden.
- Förderung der Gleichstellung: Sprache hat Macht und beeinflusst, wie wir die Welt sehen und verstehen. Eine gendergerechte Sprache kann dazu beitragen, die Gleichstellung der Geschlechter in verschiedenen Lebensbereichen zu fördern, von Bildung und Arbeit bis hin zu Medien und Politik.
Beispiel für die Wichtigkeit des Genderns
Kennen Sie das folgende Rätsel schon? „Dr. Brandt wohnt in Hamburg und hat einen Bruder in Berlin, Prof. Brandt. Prof. Brandt hat aber keinen Bruder in Hamburg“. Wie kann das sein? Viele Menschen, die mit diesem Rätsel konfrontiert werden, gehen automatisch davon aus, dass Dr. Brandt ein Mann ist. Diese Annahme basiert auf der geschlechtsspezifischen Konnotation des generischen Maskulinums, was zeigt, wie tief verwurzelt solche Stereotypen in unserer Kultur sind. Es erinnert uns daran, wie oft Frauen in der Sprache unsichtbar gemacht werden. Die Pointe des Rätsels, dass Dr. Brandt eigentlich eine Frau ist und die Schwester von Prof. Brandt verdeutlicht, wie die Sprache, die wir verwenden, direkte Auswirkungen darauf hat, wie wir die Welt wahrnehmen und interpretieren. In diesem Kontext zeigt das Rätsel nicht nur die Fallstricke unserer vorgefassten Meinungen über Geschlecht auf, sondern betont auch die Bedeutung des Genderns als Mittel, um solche voreingenommenen Annahmen zu hinterfragen und eine inklusive und gerechtere Wahrnehmung von Geschlechtern zu fördern.
Die Geschichte des Genderns
Die Geschichte des Genderns ist komplex und durch zahlreiche Entwicklungen und Debatten geprägt. Die Bewegung hin zu einer geschlechtergerechten Sprache und Rechtschreibung setzte in den 1960er-Jahren ein, als FeministInnen den Schrägstrich einführten, um Frauen in der Sprache sichtbarer zu machen. Anstatt nur „Verkäufer“ zu sagen, verwendete man die Formulierung „Verkäufer/innen“. Trotzdem war diese Form nicht unumstritten, denn sie schien die Frau als bloßen Anhang des Mannes darzustellen. Mit dem Aufschwung der feministischen Linguistik in den späten 1970er-Jahren rückte die geschlechtergerechte Sprache stärker ins Zentrum. Viele Institutionen, einschließlich der UNO, begannen, Richtlinien zu diesem Thema herauszugeben. In der Praxis blieb die Anwendung jedoch überwiegend auf akademische Kreise beschränkt.
In den 1980er-Jahren präsentierte der Journalist Christoph Busch eine neue Schreibweise, das sogenannte Binnen-I, um „Leser/-innen“ kompakter als „LeserInnen“ darzustellen. Aber auch dieses Binnen-I fand nicht überall Zustimmung, da es nur die beiden traditionellen Geschlechter berücksichtigte und in den Augen vieler, die Sprache unnötig verkomplizierte. Steffen Kitty Hermann brachte 2003 eine weitere Innovation ins Spiel: den Gender-Gap, repräsentiert durch ein Sonderzeichen, den Unterstrich. Damit sollten auch Personen sichtbar gemacht werden, die sich weder als Mann noch als Frau identifizieren.
Trotz der Entwicklung verschiedener Schreibweisen fand keine von ihnen flächendeckende Akzeptanz in der breiten Öffentlichkeit – bis auf den Genderstern*. Dieses Symbol, das in Suchmaschinen als Platzhalter dient, fand seine ersten sprachlichen Anwendungen in den englischsprachigen LGBT-Communities der 1990er-Jahre, um die Vielfalt von Geschlechtsidentitäten mit dem Sonderzeichen sichtbar zu machen. Eine neuere Methode ist der Einsatz des Doppelpunkts, der, insbesondere bei Screenreadern, als kurze Pause wahrgenommen wird und somit als besonders inklusiv gilt. Das Ende des generischen Maskulinums in seiner traditionellen Form markierte schließlich ein Update des Onlinedudens. Im Jahr 2021 setzte dieser ein starkes Zeichen für die geschlechtergerechte Sprache: Alle 12.000 Berufsbezeichnungen wurden überarbeitet. Jetzt stehen Begriffe wie „Lehrerin“, „Pfarrerin“ und „Anwältin“ stolz mit eigenen Einträgen da, anstatt lediglich als Verweise in der männlichen Form zu existieren. Ein bedeutender Schritt in Richtung Gleichstellung in der Sprache. Welche Form des Genderns sich letztlich in der Sprachpraxis durchsetzt, bleibt jedoch abzuwarten.
Gängige Methoden des Genderns im Deutschen
Wie bereits erwähnt, gibt es keine festen Rechtschreibregeln bezüglich des Genderns im Deutschen. Es gibt daher verschiedene Methoden, um geschlechtergerechte Sprache zu verwenden. Die gängigsten sind:
- Binnen-I: Dabei wird ein großgeschriebenes „I“ innerhalb eines Wortes verwendet, um beide Geschlechter zu repräsentieren. Beispiel: StudentInnen.
- Schrägstrich: Hierbei werden die männliche und weibliche Form durch einen Schrägstrich getrennt. Beispiel: Lehrer/in.
- Gender-Gap: Ein Unterstrich (_), oft auch Gender-Gap genannt, wird zwischen der männlichen und weiblichen Endung eingefügt. Er soll Menschen einschließen, die sich weder als Mann noch als Frau identifizieren. Beispiel: Lehrer_in.
- Gendersternchen (oder Gender-Stern): Ein Sternchen wird zwischen der männlichen und weiblichen Endung platziert. Es soll ebenfalls die geschlechtliche Vielfalt jenseits des binären Systems repräsentieren. Beispiel: Lehrer*innen.
- Doppelpunkt: Ein relativ neuer Ansatz, bei dem ein Doppelpunkt verwendet wird, um geschlechtliche Vielfalt darzustellen. Beispiel: Student:innen. Diese Schreibweise wird von Screen-Readern als kurze Pause interpretiert und gilt daher als inklusiv für Sehbehinderte.
- Klammern: Hier werden die Endungen in Klammern gesetzt. Beispiel: Lehrer(innen).
- Wechselform: In einem Text werden männliche und weibliche Formen abwechselnd verwendet, um beide Geschlechter gleichermaßen anzusprechen.
- Beidnennung: Auch die konsequente Beidnennung ist eine Möglichkeit. Beispiel: Lehrer und Lehrerinnen
- Neutralformen: Hierbei werden geschlechtsneutrale Begriffe oder Formulierungen gewählt. Beispiel: das Lehrpersonal statt die Lehrer oder die Lehrerinnen.
Fazit
Gendern, die bewusste Anwendung von gendergerechter Sprache, hat in den letzten Jahrzehnten vermehrt an Bedeutung gewonnen, wobei der Weg zur allgemeinen Akzeptanz noch immer von Debatten geprägt ist. Die Verwendung gendergerechter Sprache fördert nicht nur die Sichtbarkeit und Inklusion aller Geschlechter, sondern trägt auch dazu bei, Stereotypen abzubauen und das Bewusstsein für Diversität zu erhöhen. Verschiedene Methoden und Ansätze, von Binnen-I über Gender-Gap bis zum Gendersternchen, zeigen den Versuch, eine inklusive Sprache zu etablieren. Dennoch gibt es keinen universellen Ansatz, der auf breiter Front akzeptiert wird. Die jüngsten Anpassungen im Online-Duden sind ein ermutigendes Zeichen dafür, dass Institutionen den Wert und die Notwendigkeit geschlechtergerechter Sprache anerkennen. Es bleibt spannend, welche Entwicklungen die Zukunft bringt und wie sich unsere Sprache und Rechtschreibung weiter an die sich verändernde Gesellschaft anpassen wird.
E-Learning für mehr Gleichberechtigung im Unternehmen
Ein angenehmes und gleichberechtigtes Arbeitsumfeld wünschen sich die meisten Mitarbeitenden nicht nur, sie haben mit dem AGG auch einen gesetzlichen Anspruch darauf. Unser innovatives E-Learning zeigt Ihren Mitarbeitenden, wie eine harmonische Zusammenarbeit ohne Diskriminierung gelingt.